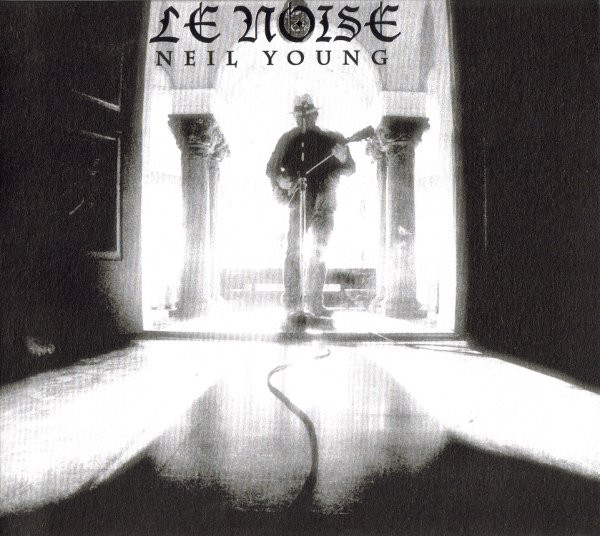Eigentlich wollte ich eine monatliche Kolumne einführen, die „Kurz mal durchgeblättert – die neue WIRE“ heißen sollte. Später, wenn diese Form der Kolumne auf Erfolg gestoßen wäre, hätte ich weitere Kolumnenfilialen eröffnet („Kurz mal durchgeblättert – die neue TAZ“, „… FREITAG“, „… SZ“, etc.). Den Terminus „Kurz mal durchgeblättert“ hätte ich mir schützen lassen. Flankierende Werbung hätte mich reich gemacht. Ein kleines Redaktionsteam hätte ich angestellt, das für mich die Zeitungen und Zeitschriften kurz mal durchgeblättert hätte, während ich mich in meinem Landhaus ganz dem Banjospiel hingegeben hätte.
Hätte, hätte, hätte.
Mein erster Versuch mit der neuen WIRE ist allerdings schon auf Seite 11 ins Stocken geraten. Ich blieb an der Nachricht hängen, dass John Cale sein 1973 aufgenommenes Album „Paris 1919“ komplett aufführen wird. Somit ist er in bester Gesellschaft mit Arthur Lee, Van Morrisson, Sonic Youth, Lou Reed und Brian Wilson, die ja ebenfalls das relativ neue Feld der Live-Komplettaufführung von ganzen Alben beackern.
John Cale nimmt sich also das Offensichtliche vor, nämlich seine musikalisch romantische Reise durch winterliche, textlich verdunkelte Unsicherheitsszenarien, statt sich, wie ich es mir gewünscht hätte, für das Nachfolgealbum „Fear“ zu entscheiden. Andererseits ist „Paris 1919“ vermutlich aber auch die interessantere Wahl, hat Cale doch auf „Fear“ (1974) und auf den folgenden Alben „Slow Dazzle“ (1975), „Helen Of Troy“ (1976) und „Sabotage /Live“ (1979) die Angst als beherrschendes Thema schon in allen Formen durchgeschmeckt und durchgeschrien – als Tröster, als Knarre, als Freund, als Atombombe, als Söldner, als Elvis. Irgendwann ist dann auch mal gut. Da bietet im Gegenzug das mit der Band Little Feat eingespielte und sinfonisch gediegen aufgebrezelte „Paris 1919“ vielleicht wirklich ein um einige Nuancen reicheres Bild. 
„Paris 1919“ ist der Versuch, auf die denkbar netteste Weise etwas sehr Hässliches zu sagen, wie John Cale in seiner Autobiographie „What’s Welsh For ZEN“ (1999) erklärt. Eine Technik, die Cale dem amerikanischen Songwriter Jackson Browne abgeschaut hat, dessen frühe Platten ihm Nico nahebrachte. Cale verteilt einige am seidenden Faden hängende Schicksale auf die Songs. Eine dandyeske Welt, in der sich paranoide, alternde Moviequeens und manipulierte Macbeths gute Nacht sagen, und man sich zum Tee mit Graham Greene trifft, während ein Spion auf seiner Zugfahrt „somewhere between Dunkirk and Paris“ über seine Situation sinniert („From now on it’s gonna be/ A simple case of them or me/ If they’re alive than I am dead/ Thank God and eat your daily bread/ Take your time“).
Die Helden des einschmeichelnd romantisch arrangierten Song-Reigens sind weit, weit entfernt. Entfernt von dem Ort, zu dem sie gehören, von der Zeit, nach der sie sich sehnen und vom Wohlstand, den sie eben noch ganz selbstverständlich für sich beansprucht haben und der nun von anderen vernichtet wird („So save yourselves for the hounds of hell/ They can have you all to themselves/ Since the fashion now is to give away/ All the things you love so well“, aus „Graham Greene“). 
Ein Leben an der plötzlich nicht mehr tragfähigen Bruchkante des Bürgertums, mit der auch vormals sicher geglaubte ökonomische und soziale Zugehörigkeiten wegbrechen. Auf der Rückseite von „Paris 1919“ sieht man John Cale im tadellosen, weißen Dandy-Outfit in Weichzeichner-Ästhetik stehen. Innerhalb einer Sequenz von vier Fotos kippt der starre Lebemann um, wie von der Axt gefällt. „Welcome back to Chipping and Sodbury/ You can have another chance/ It must all seem like second nature/ Chopping down the people where they stand“, gibt Cale die zynische Losung fürs Überleben aus. Sei skrupellos und hack die Leute um, wo sie stehen. Eine dritte Chance bekommst du nicht.
Das Titelstück handelt in kinderliedartiger Form von nicht greifbaren Beziehungen. „You’re a ghost la la la la“, flötet John Cale dem Hörer hinterher, „yes, your’re a ghost, la la la la“, und gibt gleich darauf einen Hinweis, wer derlei körperlose Desorientierung gerne in seine Herde integrieren möchte (…and I’m the Bishop and I’ve come/ To claim you with my iron drum/ la la la la“). Fast vier Jahrzehnte nach Erscheinen von „Paris 1919“ schwirren die Geister – la la la la – zusammenhanglos in elektronischen, „sozialen“ Netzwerken herum. Die Menge trifft sich zum Flashmob, man lacht kurz zusammen über den gelungenen Coup, filmt sich selbst wie eine fleischgewordene Überwachungskamera und geht dann wieder an den Rechner. „Efficiency efficiency they say/ Get to know the date and tell the time of day/ As the crowds begin complaining/ How the Beaujolais is raining/ Down on darkened meetings on the Champs Elysée“.
Als Orientierungsangebot in Zeiten der existenzbedrohenden materiellen Unsicherheit etabliert sich verstärkt der Glaube. Auch „Paris 1919“ ist durchsetzt mit angstbesetzten, religiösen Untergünden („Nothing frightens me more/ Than religion at my door“, aus „Hanky Panky Nohow“) und dazu passt auch eine kleine Fußnote, die Cales Autobiographie entnommen ist: Der Bassist auf „Paris 1919“, Wilton Felder, war kein Bandmitgleid von Little Feat. Er war ein methodistischer Prediger, der statt Notenblätter die Bibel auf seinem Notenständer aufgeschlagen hatte, um sie während des Spielens zu studieren. In einer Probenpause fragte ihn Gitarrist Lowell George, was er denn da lesen würde, und gegen Ende der Pause sah John Cale, wie Lowell George vier Dollar aus seiner Tasche fingerte, um eine von Felders Bibeln zu kaufen. Wie war das noch mit der Angst linker Atheisten vor religiöser Einflussnahme? So schnell kann’s gehen.
Und apropos Einflussnahme: Lässt sich die Manipulation, mit der Lady Macbeth ihren Mann steuert („You never saw things quite that way/ She knew it all/ And made you see things all her way“, aus „Macbeth“, dem einzigen brachialen Rocker auf der Platte), nicht auch als geschicktes Datensammel-Management eines einschlägig bekannten Netzinformationsgiganten deuten?
Wie man sieht, kommt da schon so einiges zusammen auf „Paris 1919“, das sich im Kontext heutiger globaler wirtschaftlicher und sozialer Konkurrenz und der sie begleitenden medialen Aufrüstung ziemlich aktuell lesen lässt.
Interessanterweise stammt mein LP-Exemplar von „Paris 1919“ aus einer Sonderedition von 1977, die sich „Music & Art Collection“ nennt und die sich zur Aufgabe machte, Musik und Bildende Kunst miteinander zu verbinden. Der Hamburger Grafiker und Künstler Peter Paul lässt sich von „Paris 1919“ zu einer Lithografie mit drei schmucklosen, grauen Hochhäusern inspirieren. Sie sehen aus wie entkernte Wohnutopien, die sich in einen entindividualisierten Wohnalbtraum verwandelt haben. Der Klappentext spricht von „kapitalistischem Impressionismus“. Im Internet ist das Bild leider nicht aufzutreiben. Soviel sei aber verraten: Es gibt noch nicht mal mehr Autos, die in Brand gesetzt werden könnten.
Am 5. März wird John Cale das komplette Album in der London’s Royal Festival Hall aufführen. Das Heritage Orchestra hilft ihm dabei. Ein würdiger Ort für ein derart ambivalentes Werk. Ein romantischer Songzyklus, dem man nicht trauen kann. Ich wüsste nicht, wie man Sehnsüchte und Wirklichkeiten im Moment besser abbilden könnte.