ANNIE CLARK a.k.a. ST. VINCENT
Ende der 1990er Jahre begann sich die Musikrezeption in den Musikmagazinen zu ändern. Zum einen wegen des vermehrten Aufkommens elektronischer Musik, die immer abstrakter zu werden schien, je mehr Menschen sie dazu befähigte, ohne andere Mitspieler Musik zu entwickeln. Die hohe Abstraktion machte es schwierig, der Musik eindeutige Inhalte und Zusammenhänge zuzuordnen, die über ihren Klang hinausgingen. Zum anderen fing langsam die Share-Kultur an, Musiken waren plötzlich schnell und immer problemloser verfügbar und mit zunehmender Audio-Flut auf der Festplatte purzelten ihre Entstehungszusammenhänge durcheinander. Der Kontext von Musik wurde immer weniger wahrgenommen, Musik wurde gleichzeitig immer weniger in Genres klassifiziert – oder eben in unendlich vielen Genres, was auf das Gleiche hinauslief, nämlich auf einer zunehmenden Bedeutungslosigkeit der Zuordnungen.
Viele Musikmagazine, die ihre Daseinsberechtigung zum einen aus der Kanonisierung von Musik in ihrem linearen Geschichtszusammenhang und zum anderen aus der Kreierung von „Genres“ speisten – Diszipline, mit denen Musikmagazine seit jeher versuchen, einen Wissensvorsprung zu installieren, dessen Egalisierung das Kaufargument für den Leser darstellen soll („Mitreden können“) – hatten Schwierigkeiten, neue (oft elektronische) Musik, für die der Kanon noch nicht greift, journalistisch aufzubereiten. Die Strategie war dann entweder, den eigenen Kanon dadurch zu zementieren, dass neue Musik an ihr scheitert („Alles schon mal dagewesen“) und quasi als Folge davon Wiederveröffentlichungen zum Anlass zu nehmen, den zementierten Kanon endlos wiederzukäuen; oder man ging weg von den geschichtlichen Zusammenhängen und konzentrierte sich mehr auf die Struktur der Musik selbst.
Stellvertretend für den herkömmlichen Weg der Kanonisierung steht das britische MOJO-Magazin, das oft in immerhin sehr gewissenhaft recherchierten Artikeln immer wieder die „alten Helden“ besingt, sobald wieder ein Jubiläum und/oder eine Wiederveröffentlichung in Form opulenter CD-Boxen winkt. Stellvertretend für den anderen Weg, nämlich die Musik innerhalb ihrer Strukturen zu beschreiben, steht vielleicht die WIRE oder die DE:BUG, die Musik mehr über ihren Klang, ihre Oberfläche und tieferliegende akustische Strukturen beschreiben und weniger über ihre Bedeutung als Pop, Rock, Elektronik oder was auch immer. Das Stichwort, an dem sich in diesem Zusammenhang häufig entlang gehangelt wird, ist die „Textur“ der Musik.
Der Vorteil von der Betrachtung von Musiktexturen: Sie ist eine Möglichkeit, Musik ein wenig aus ihrem Zeit- und Gesellschaftskontext zu lösen. Man muss nicht dauernd nach Zusammenhängen Ausschau halten, sondern kann Musik mit einem freieren Blick wahrnehmen. Das funktioniert nicht nur bei neuer, noch nie gehörter Musik, sondern ist auch ganz nützlich bei Musik, die man aufgrund ihres für den Hörer individuell prägenden Geschichtszusammenhangs nicht mehr hören mag, aber die man durch die Konzentration auf die Klangstrukturen wieder unter anderem Blickwinkel für sich entdecken kann. Dabei wird der Kulturzusammenhang nicht ausgelöscht – er kann gar nicht anders als immer zu bestehen, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen – er wird nur leichter gewichtet. Ich habe mir mit dieser texturellen Betrachtungsweise zum Beispiel wieder „Like A Hurricane“ von Neil Young ‚geholt‘, ein Song, den ich lange Zeit aufgrund der starken Verhaftung mit einer früheren Lebensphase komplett für alle Zeiten als unhörbar durchgenudelt empfand.
ST. VINCENT strange mercy
2011
Soll es hier wirklich noch um St. Vincent’s „Strange Mercy“ gehen, der dritten Platte der so zerbrechlich erscheinenden Annie Clark aus Austin, Texas? Unbedingt. Denn es ist eine ideale Platte für die Betrachtung von Texturen, in diesem Fall von eher selten zerbrechlichen, dafür oft genug durchaus unerwartet sperrigen bis brachialen Texturen, und zwar besonders von solchen, die von Synthesizern und ähnlichem elektronischen Zeug hergestellt worden sind.
„Strange Mercy“ ist nämlich vor allem eine Synthesizer-Platte. Sie quietscht, wird laut und ausfallend, beruhigt dann wieder, findet immer wieder ihren Platz im Groove, legt samtene Flokati aus, aus denen plötzlich spitze Nägel hervorluken, sobald man beginnt sich einzukuscheln. Sie enthält viele abstrakte, auch anstrengende Elemente und ist gleichzeitig als Songsammlung konzipiert, ist also nicht nur für einen kleinen Kreis von Freunden ‚freier‘ Musik interessant, sondern ein klassisches, in drei- bis vierminütigen Häppchen unterteiltes Album. Jeder Song unterscheidet sich dabei grundsätzlich von den anderen. Die viele Wagnisse führen dazu, dass „Strange Mercy“ polarisiert. Es gibt mehr glühende Ablehner, als glühende Befürworter, wenn ich mal so Revue passieren lasse, was im Bekanntenkreis und in Foren so erzählt wird. Es gibt nicht viele Listen, wo „Strange Mercy“ ganz oben steht, wenn sie überhaupt dort Erwähnung findet. Anzutreffen ist der Vorwurf, das Album wäre too much. Zuviele Schichten, zuviele Elemente, zuviel Progressivität auch im Vergleich zu vorherigen Arbeiten von St. Vincent, zu anstrengend, zuviele gekünstelte Wendungen vielleicht auch.
Dabei ist „Strange Mercy“ als Chart-affines Pop-Album konzipiert. Man merkt es an der edlen Aufmachung. Die LP-Version zum Beispiel steckt in einem in der Herstellung sicher nicht ganz billigen Klappcover, Buchstaben sind in das Cover eingedruckt und leuchten in luxuriösem Lila-Rot auf beigem Hintergrund edel fallender Stoffe. 4AD, das Label, steht sowieso für diese Art der kunstvollen Gestaltung. Aber trotzdem „Strange Mercy“ ein Pop-Album ist, will es nicht von allen gemocht werden, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es will auch mal überfordern, krachen und fies im Ohr sirren. Aus St. Vincents E-Gitarre schnellen dünne Verzerrungen, die nicht an Akkorden interessiert zu sein scheinen. Sie platzen mehr als Effekt und Sound in die Songs, wie ein ungebetener Überraschungsgast.
Der allumspannende Einsatz von Synthesizerspuren spielt immer mit mindestens einer Vintage-Komponente gleichzeitig. Mal lullt er ein, als würde er riesige Wattewolken aus dem Mainstream-Himmel der 1980er Jahre heranziehen, dann wieder hat er einige sehr große Augenblicke, wenn er wirklich kreischende Soli aus heiterem Himmel einstreut, denen auch ein alter Analog-Synthie-Störgeräusch-Erzeuger wie Allan Ravenstine in einen Pere-Ubu-Jahren seinen Segen gegeben hätte.
„Northern Lights“ ist einer dieser Tracks, wo kreischende Parts plötzlich mit gedehnten Refrains abwechseln, die sich – immer ein guter Effekt – in langsamem Tempo auf den schnellen Hintergrund legen, und dann plötzlich geht ein Synthie-Schrei los, der in den femininen Vokal-Schrei St. Vincents übergeht, aus dem heraus dann NOCHMAL wieder der Synthesizer ansetzt zu einem NOCH freieren, kreischenden Solo. „Strange Mercy“ ist voll von solch gewagten Auftürmungen. Und so ist sie diejenige Platte des Jahres 2011, die die alte Kunst des Draufpackens-wenn-man-denkt- es-geht-nichts-mehr-Draufzupacken mit am überzeugendsten kompositorisch fernab des Zufalls umgesetzt hat. Und mal ehrlich, was spricht denn dagegen, nicht auch im März 2012 noch ein gekonnt mit Fiesheiten aufgehässlichtes Popalbum von 2011 zu hören? Das Aktualitätsdiktat? Da sei drüber gelacht.




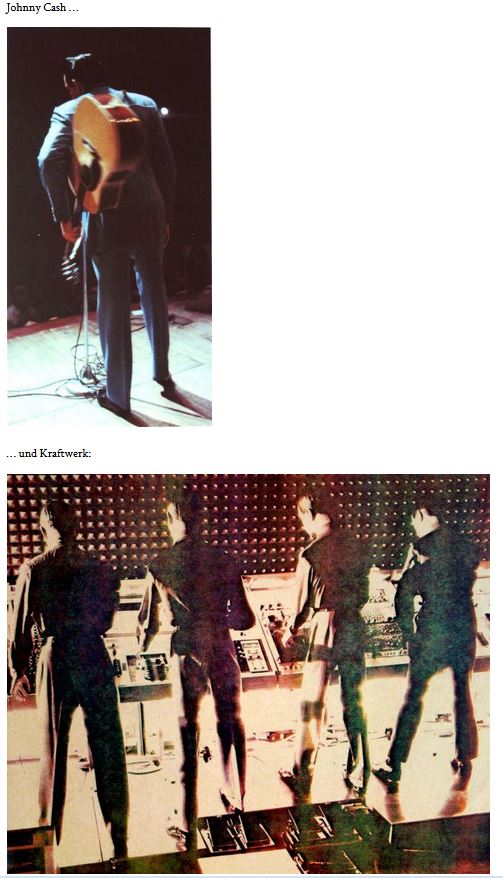
hab die frau clark mal im vorprogramm von 'the national' gesehen, hat mich ehrlich gesagt nicht gerade umgehauen. auch mit den ersten beiden tonträgern bin ich nicht zurecht gekommen. die hier besprochene scheibe kenne ich zugegebenermassen nicht. "nett anzuschauen, langweilig anzuhören", würde der chauvi in mir sagen.
grüße,
g.
p.s. die ausführungen zum bob-marley-post kann ich nur unterschreiben.
Danke, g.
Ich finde, Annie Clark hat mit Strange Mercy nochmal einen ganz speziellen Entwicklungssprung hingelegt. Sie geht ganz anders in die Vollen als vorher noch. Und was mir besonders gefällt: Obwohl sie "professioneller" und "teurer" klingt, ist sie eher noch weniger um Gefallen bemüht. Sie scheint mir an ihrer Kunst zu schrauben und nicht an ihrer Karriere.
da bin ich dabei, auf den kommerziellen erfolg schielt die gute mit dieser art der musikalischen darbietung nicht. insofern schon wieder sympathisch, die annie…
grüße,
g.