Zu Keith Richards 80stem bringt Lärmpolitik eine überarbeitete Track-By-Track-Review-Version von Sticky Fingers heraus.
Bewertung: ***** gut. * nicht so.
The Rolling Stones – Sticky Fingers (1971)
A1. Brown Sugar
Brown Sugar ist Teil zwei der von mir so benannten „Singles-Trilogie zweifelhafter Etablissements“, die die Stones mit Honky Tonk Woman begonnen haben. Die Trilogie startet mit dessen „gin-soaked barroom queen in Memphis“, macht einen Schlenker ins New Orleans zu Zeiten der Sklaverei zu einer mutmaßlichen Tochter einer „Tentshow Queen“ (Brown Sugar) und findet ihren Endpunkt in Tumbling Dice, der Hommage an abgerissene Spielerspelunken mit Hinterzimmervergnügungen. Um Tumbling Dice herum wurde dann schließlich sogar eine ganze Doppel-LP gebaut, die fast zur Gänze in und vor Kneipen spielte und deren Texte sich in der Kotze am Bordsteinrand spiegelten, falls das nach den Gesetzen der Optik überhaupt möglich ist.
Von der Trilogie gefällt mir Tumbling Dice am besten, weil es sich unberechenbar und vielstimmig um sich selbst windet und den Groove dabei hinter sich herschleppt, während Brown Sugar eben der Riff-Rocker ist, der schon bei Honky Tonk Woman gut als Single funktionierte, den ich mir aber mittlerweile nicht mehr freiwillig antue – außer ich binde mir aus einem inneren Zwang heraus Track-By-Track-Projekte zu Stones-Alben ans Bein.
Allesamt jedenfalls raue Orte, die die drei Songs auskleiden, auf das die Rauheit auf die Band abfärben möge, die sich andererseits aber von ihrem eigenen Rauheitsimage auf feudalen Landsitzen erholen konnte (falls nicht gerade ein Feuer ausbrach), was den meisten realen Bordsteinrand-Existenzen wohl eher nicht vergönnt war und ist. Der Text von Brown Sugar ist in die Kritik geraten, weil er aus der Perspektive weißer, britischer Unterdrücker das Schicksal schwarzer versklavter Frauen beschreibt. Inklusive sexistischer und rassistischer Sichtweisen, die bei den weißen Herren mitschwingen. Darauf dann einen tanzbaren Bluesrock-Stomper aufzubauen, kann schon mal zu der Annahme führen, hier würde genau so ein Weltbild als erstrebenswert propagiert. Jagger selbst hatte bei den Tourneen aktueller Jahre kein Problem damit, den Track wegen der Kritik aus dem Programm zu nehmen. Sei es, weil er selbst den Text so möglicherweise nicht mehr schreiben würde, sei es, weil er ihn vielleicht schon immer im Detail für nicht so wichtig erachtet hat, sondern mit ihm nur eine allgemeine Wirkung erreichen wollte: Das eigene provokante Image aus Tabubruch und Rock’n’Roll-Körperlichkeit gezielt zu festigen. Es bleibt ambivalent, so wie sexistischer Rotz eben sexistischer Rotz bleibt. Eine Ambivalenz, die sich eben kaum auflösen lässt, wenn man sich von Musik und Performance mitreißen lässt, was auch in dem Reader „Under My Thumb – Songs That Hate Women And The Women Who Love Them“ zum Ausdruck kommt, wo die Bloggerin und Autorin Manon Steiner in ihren Beitrag über Mick Jaggers Texte und die Wirkung der Rolling Stones den Sexismus als Teilaspekt unter vielen einsortiert, um sich nicht nehmen zu lassen, sich in die Energie zu begeben, die Rock’n’Roll ausmachen kann.
Brown Sugar vermittelt nicht nur über den Text ein Southern-Gefühl. Die Gitarren werden übersichtlich verwoben, die Musik prägt sich gleich ein, die Bläser schneiden sich weder zu wohlgefällig noch zu überlastend in den Track, der Refrain ist mitsingbar. Kurz: Der Song wurde zum Hit gezwungen. Ich kann’s zwar nicht mehr so recht mit Genuss anhören, finde aber, die Stones haben einen guten, wenn auch keinen herausragenden Stampfer abgeliefert. Man rockt beschwingt und etwas bedrohlich voran, der Text liefert eine schöne Gelegenheit, einen Sklavengaleeren-Beat drunterzutrommeln. Die Stones standen ja damals unter ziemlichem Druck, von wegen erstes Album auf eigenem Label, länger nichts veröffentlicht, Post-Altamont, Steuerflucht. Da war die Zukunft der noch nicht mal zehn Jahre existierenden Band alles andere als gesichert. Insofern gibt der Erfolg von Brown Sugar ihnen recht. Es war die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Ich kann es an dieser frühen Stelle des Textes schon mal verraten: Ich halte Sticky Fingers insgesamt für ein gediegenes Nummer-Sicher-Album, das sich ein paar zeitgenössische Zutaten der Rockmusik aus den Anfängen der 1970er Jahre gegriffen hat (britisches Blues-Revival, Funkbläser, Southern Soul) und in qualitativ gut zu genießende, milde skandalisierte (Hosenreissverschluss! Slip! Illegale Drogen! Bitch!), aber trotzdem nicht vom Kauf abschreckende Anreize überführte.
***1/2
A2. Sway
Dunkel anschleichender Rhythm&Blues, noch ein bisschen auf der Dämonenwelle reitend, die sich ja bekanntlich in Altamont jäh brach. Sway kann den magischen Bann musikalisch gut umsetzen. Der geheimnisvollste Track auf Sticky Fingers.
****1/2
A3. Wild Horses
Wenn man sich unzählige Male durch den Krach von Some Girls gehört hat, wird man leicht ungeduldig, wenn dann sowas wie Wild Horses um die Ecke trabt, wie schön es auch sein mag. Früher für mich ein sicherer Fünfsterner, scheint mir der Song mittlerweile etwas unnötig lange auf der Stelle zu treten, obwohl ja das Immer-noch-Festhalten an einer mindestens der Trennung sehr nahen Liebesbeziehung das Hauptthema des Songs ist, von dem sich der Sänger/Protagonist noch nicht wegbewegen mag. Daher kommt der Song nicht in die Hufe, die Wilden Pferge werden zum Ende hin aber zumindest für die Zukunft versprochen („We’ll ride them some day“). Der Song soll also gar nicht rocken, er soll gar nicht rollen. Er soll countryfolken und wird dabei vom dezent im Nudie Suit gekleideten Gram Parsons herbeigewunken. Und wie vieles, was von Gram Parsons herbeigewunken wurde, endet es nicht ohne Trauer und Leid. Ein überaus schöner Song nach wie vor, ein unkitschiger Tränenlöser für selbsterlittenes Trennungsleid, aber einen halben Stern hat der Song auf seinem gemächlichen Ritt durch die Prärie dann doch verloren.
****1/2
A4. Can’t You Hear Me Knocking
Da bin ich mit den Richards-Riff-Verklärern, nein –Verehrern: Das ist wirklich ein tolles Gitarrenmotiv, das er da zu Anfang raushaut. Auch der Rest ist ohne Fehl und Tadel. Mit das Perfekteste, was die Stones je abgeliefert haben. Selbst den damals grassierenden Santana-Latino-Touch, der die zweite Hälfte des Songs bestimmt, wuppen sie grandios. Taylors Solo gießt sich in den Song wie flüssiges Gold aus der Schatzkammer El Dorados. Überhaupt ist er hier vollständig in den Sound integriert, was man gut daran erkennen kann, dass er irgendwann ein Motiv entwickelt, dass der Rest der Mannschaft dann aufnimmt und konsequent dynamisiert. Jagger singt auch ganz großartig, weil kräftig, ohne zu übertreiben. Neben diesen offensichtlichen Höhepunkten ist mein heimlicher Höhepunkt die Stelle so nach viereinhalb Minuten, wo Richards Gitarre gegen den Beat arbeitet und dabei mit der Orgel zu einem knappen funky Knarren zusammenschmilzt, falls es denn überhaupt möglich sein sollte, zu einem Knarren zusammenzuschmilzen. Aber wenn Helge Schneider es schafft, ein Stück Papier in zwei Teile zu knüllen, dann kann ich ja wohl auch aus Geschmolzenem ein Knarren heraushören.
*****
A5. You Gotta Move
Hat den Beteiligten bestimmt Spaß gemacht, so zwischen den Tourterminen ein Studio zu buchen und mal mit der ganzen Mannschaft ein bisschen Blues zu spielen und zu singen. Ist aber nicht so mein Fall. Für einen Country-Blues zu glatt, für einen urbanen Blues zu undynamisch. Ich mag auch einfach dieses Blues-Schema nicht. Oder nicht mehr. Oder schon lange nicht mehr. Und wenn doch, dann eben mit einem gewissen Etwas gespielt/produziert. Der fehlt mir hier.
Überhaupt liegt auf den ganzen Album ein leichter Dunst des sich gerade schon im Verziehen befindende Britische Blues Revival, das in den 1960ern seinen Anfang nahm und Ende der 1960er Jahre seinen Höhepunkt erlebte. Gruppen wie Ten Years After oder Chicken Shack oder John Mayall oder Eric Clapton taten so, als würden sie es in der Leidensgeschichte mit ihren scharzen Kollegen aufnehmen können, jammerten über den Kater am morgen und die Einsamkeit nach dem Aufstehen. Die Stones immerhin hatten auf Beggars Banquet und Let It Bleed in die Inszenierung echten Blues-Leidens noch ironische Pop-Spins eingebaut. Die fehlen auf You Gotta Move aber, und so schleppt sich das Stück dahin, herausgerissen aus seinem Zusammenhang, den ich mir so vorstelle, dass alle Beteiligten im Muscle Shoals zum Aufwärmen ein bisschen was zum Covern brauchten.
**1/2
B1. Bitch
Zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits finde ich Bitch mittlerweile besser als Brown Sugar, andererseits überschattet aber die Existenz von Bitch als dessen Single B-Seite diesen Hörgenuss. Denn Single B-Seiten sind schlechter und weniger wichtig als Single A-Seiten. So habe ich es als Kind gelernt. Und leider behält man vieles bei, was man als Kind und Heranwachsender gelernt hat, ja, in zunehmendem Alter holt man sich von dem unseligen Kram sogar noch einiges zurück. Gedankenverlorenes Nasepuhlen in der Öffentlichkeit zum Beispiel; sich total aufregen, wenn man etwas aus Rücksichtnahme nicht mehr machen darf und sich einbilden, einem würde damit unfassbares Leid zugefügt, was nur mit den schlimmsten Menschheitsverbrechen vergleichbar wäre zum Beispiel. Bei mir ist es weniger schlimm ausgeprägt (außer dem Nasepuhlen vielleicht), aber der Glaube, Bitch wäre weniger wert als Brown Sugar, hat sich mir leider erhalten. Weil ich die Single vor dem Album kannte. Deswegen ist Bitch für mich immer ein “B-Seite von irgendwas”-Song. Das soll jetzt aber mal für einen Augenblick nur mein Problem bleiben.
Denn zieht man die eigenen unwichtigen Mythen ab, mit denen man in der Kindheit versucht hat, die Welt in verlässliche Bahnen zu lenken, dann wird Bitch zum zweitbesten Rocker der Platte, hinter Sway und vor Brown Sugar. Gitarren werden nicht so sehr verknäuelt – weil Verknäuler Wood noch fehlt – dafür klingt das Gitarrensolo wie in den Song geworfen. Dann in der zweiten Hälfte des Solos ist es aber super und treibt richtig an. Und überhaupt fällt mir jetzt an Bitch wieder auf, wie aufgeräumt und ordentlich doch Sticky Fingers ist. So vieles sitzt wohlgesetzt am richtigen Ort. Jederzeit ist es möglich, die Gitarren rechts- oder linkskanalig zu verfolgen. Dies ist Musik, die nicht auf hartem Parkettboden im Schneidersitz entstanden ist (Beggars Banquet). Problemlos darf man lauschen, wie da so ein paar Melodie-Licks gesetzt werden. Die Bläser sind präsent, Jagger singt klar vernehmlich. Alle Mikros sind optimal positioniert, keine Kabel bilden Stolperfallen. Irgendwie war das musikalisch alles viel erwachsener und abgeklärter als sieben Jahre später auf dem dem so wunderbar ruffen und knalligen Gesamtsound von Some Girls oder noch später auf dem verstrubbelten, querstehenden Klops namens Dirty Work. Aber eben dadurch auch manchmal etwas weniger aufregend.
****
B2. I Got The Blues
Letzter Himmelskörper des Dreigestirns, das mit No Expectations seinen Anfang nahm, mit Love In Vain fortgesetzt wurde und schließlich bei I Got The Blues endete. Nach wie vor ein guter Song, wenn auch nicht (mehr) ganz so gut wie seine Geschwister. Song und Umsetzung sind in die Jahre gekommen, finde ich. Klingt doch recht bluesrevival-esk. Bisschen formelhaftes Grundthema auch, aber die Bläser und besonders das schneidige Orgelsolo reißen wieder was raus. Jagger habe ich schon gefühlvoller gehört. Er drückt mir zuviel rein. Ich höre einen technisch guten Sänger singen. Bei Al Green z.B. höre ich nie einen technisch guten Sänger singen, weil Al Green diesen abstrakten Gedanken gar nicht aufkommen lässt (und was ihm eben genau dadurch gelingt, dass er ein so verdammt guter technischer Sänger ist!). Über Al Green kann ich nur nachdenken und schreiben, wenn ich ihn nicht höre. Na, ich schweife ab. Zurück zum Song: Vielleicht liegen meine kleinen Probleme mit I Got The Blues auch darin begründet, dass Zeilen wie „I got the blues for you“ und ähnliche über die Jahrzehnte schon so klischeesiert verwendet wurden, dass sie für mich außer dem Klischee kaum noch etwas anderes transportieren, egal wie gut der Sänger auch sein mag. Caetano Veloso hat das Problem mit dem generellen Blues-Klischee mal im Anfangsvers von Nostalgia (That’s What Rock’n’Roll Is All About) schön auf den Punkt gebracht: „You sing about waking up in the morning / But you’re never up before noon …“.
***1/2
B3. Sister Morphine
Geht mir wieder so ähnlich wie bei Wild Horses: Der Anfang zieht sich ganz schön. Auch wenn’s hier thematisch gut passt, weil der Protagonist aus dem Drogenkoma erwacht. Ist aber insgesamt ein tolles Stück nach wie vor. Wir wissen alle, wer die Lyrics verfasst hat. Jagger singt wieder sehr gut und der Song entwickelt einen tollen Sog. Die Drums sind ebenfalls sehr gut eingesetzt.
****1/2
B4. Dead Flowers
Ein sehr schöner Song, den selbst Townes Van Zandt mal gecovert hat. Ich ziehe zwar Far Away Eyes etwas vor, aber trotzdem ist Dead Flowers eine fließende halb ernst gemeinte, halb amerikanisch geknödelte Country-Parodie, zu dem mir aber leider ansonsten gerade nichts Besonderes einfällt. Außer vielleicht, dass mich spätestens auf Dead Flowers das Stone‘sche kokettieren mit Heroin, Koks und ein Leben in schlechter Gesellschaft auf den Keks zu gehen beginnt.
****1/2[
B5. Moonlight Mile
Sehnsuchtsorte + Outroludes, Teil 2. Auf drei Alben ist jeweils ein Song vertreten, der ähnlich irreale Sehnsuchtsorte beschreibt wie Moonlight Mile. Sie gehören zuammen wie drei Elektroden, die über das ganze Universum verteilt sein können und trotzdem zur selben Zeit und für immer miteinander verbunden im selben Spin schwingen. Über ihre Gemeinsamkeiten werde ich an anderen Stellen etwas schreiben. Nur so viel zu Moonlight Mile an dieser Stelle: Jaggers ganz großartiges Motiv auf der Akustikgitarre; die irreale Stimmung, als würde man über mysteriöse Hochebenen fahren, im Halbdelirium sie gleichzeitig genießen und sich doch nach ihrem Ende sehnen. Top 5 im Himmel der Stonestracks (auch was Jaggers Gesangsleistung betrifft). Und das ohne einen einzigen Ton von Keith Richards. Das Outrolude kommt besonders zur Geltung, wenn man Sticky Fingers von vorne bis hinten durchgehört hat und dann während man verträumt auf der Mondmeile reitet, nochmal alles Revue passieren lässt. Ich hab halt auch Gefühle.
*****
—————–
Von den großen drei Alben, die die Stones von 1968-71 herausbrachten, macht Sticky Fingers den wohl aufgeräumtesten, auch unter unternehmerischen Aspekten durchgeplantesten Eindruck. Das beginnt schon mit dem Cover. Wohldosierte Moralverletzung, um in Ländern, die verkaufstechnisch weniger interessant sind, ins Gerede zu kommen (böse Buben Image check). Andy Warhol als a) hofierter Künstler der amerikanischen Popkultur (Boheme’n’Pop check), b) der Oberflächen und Massenprodukte und ihrer Verwertung als Ware (Kaufanreiz und gleichzeitige Kritik des Kaufanreizes checkcheck), c) der amerikanischen Kult-Ikonen (Steigerung der awareness am weltgrößten Plattenmarkt USA check). Sticky Fingers als erstes Fokusprodukt der neugegründeten Firma The Rolling Stones und dem firmeneigenen Plattenlabel Rolling Stones Records. Ein Unternehmenslogo wurde eingeführt und auf dem der Platte beigefügten Inlay übergroß präsentiert (Trademark check). Die Schrift davor so klein und dünn, das sie garantiert nicht vom Logo ablenken kann. It’s the markenkern, not the song. Jahrzehnte später werden Alben der Stones nur noch um dieses Zungenlogo herum designt. Immer gleiches Motiv in zahlreichen Varianten. Mal blau, mal gelb, mal lila. Das Universum wird noch viele weitere Farben bereit stellen. Eine unternehmerische Erfolgsgeschichte (∞ check).
Ich weiß, dass viele Stones-Hörer Sticky Fingers für ihr bestes Album halten. Und das ist auch verständlich. Kaum ein anderes von ihnen ist ausformulierter, operiert auf beständig hohem kompositorischen Niveau, lädt so sehr zum Eintauchen ein. Man kann sich am makellosen Taylor-Solo auf Can‘t You Hear Me Knocking erfreuen, schmeckt das Delirium eines Morphiumrausches von Sister Morphine ohne Nebenwirkungen nach, gibt sich der tiefen Liebe und dem wohligen Schauer einer romantischen Todessehnsucht von Wild Horses hin, genießt auf Brown Sugar den Rhythm & Blues im Southern-Stil, lässt sich durch den makellosen Rocker Bitch treiben und vom rätselhaften Sway in seinen dunklen Bann ziehen, fantasiert sich in den zerlumpten Junkie rein, der von seiner Susie welke Blumen geschickt haben möchte und als Gegenleistung Rosen auf ihr Grab legen würde, und landet schließlich eine Mondmeile entfernt an einem Sehnsuchtsort, der wohl kaum zuvor schon einmal so magisch besungen worden ist. Man kann es sich also gemütlich machen auf der Lieblingssitzgelegenheit im Lieblingsmusikhörzimmer und über das Lieblings-HiFi-Gear die Makellosigkeit dieser Platte noch etwas makelloser genießen.
Man kann es aber auch so sehen, dass es einem Sticky Fingers vielleicht doch etwas zu leicht macht mit dem Mögen. Etwas zu bequem ist in der Makellosigkeit. Etwas zu oft für jeden Popmusik-Interessierten deliziöse Melodien bereithät. Eine Genießerplatte. Das ist sicher dem Erfolgsdruck geschuldet, denn Sticky Fingers war wichtig für das Fortkommen der Stones – erstmals waren sie mit eigenem Label und eigener Unternehmung am Start, als Steuerflüchtlinge in der Kritik, Altamont als mörderischen Schatten noch im Nacken. Und die Stones sollten mit der Entscheidung recht behalten. Sticky Fingers wurde ein künstlerischer und kommerzieller Erfolg. Ein sorgfältig hergestelltes Produkt, das auch für die anstehenden Tourneen genug Material für überzeugende Inszenierungen als faszinierend verdrogte, modebewusste Typen mit Gefahrenpotenzial abwarf. Sei ein Teil unserer edel zerlumpten Gesellschaft! Ein gutes Jahr später sollte ein anderes Album folgen, kratzbürstig, ausgebeult, ungemütlich, skelettiert, offensiv, von Fliegen umschwirrt, die nicht zu verscheuchen waren. Das wirklich a mess war und ist.
****


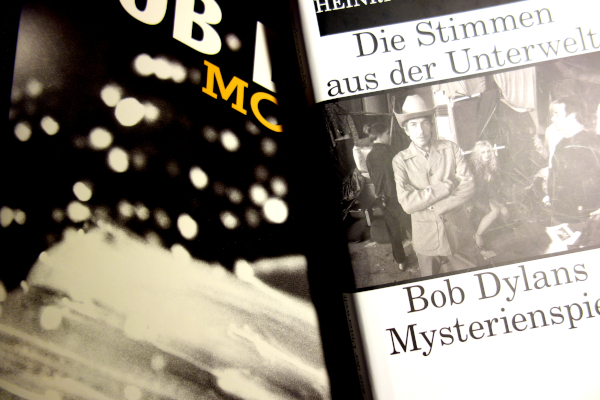
D’accord. Ich habe Sticky Fingers schon eine Weile nicht mehr gehört, und gestern Abend dann in Ruhe unterm Kopfhörer in Gänze überprüft. Can’t You Hear Me Knocking hat mich noch nie richtig abgeholt. Zu viel Santana – stimmt! Wild Horses, Sister M., und Dead Flowers (auch wg. TVZ): check. Aber die beiden besten tracks für mich sind: Sway und Moonlight Mile. Beides: Jahrhundert-Songs mit enormen spirituellen Energien. (Next stop: Heaven & Time Waits For No One.) Beide ohne Keef, aber Mick Taylors mühelose Gitarren-Arbeit ist unglaublich. Er spielt wie ein Engel. Alle seine Soli und jedes Lick singen und jubeln und seufzen. Innere Melodien galore. Gold indeed. Und er war erst 21. Welches Reservoir hat er da angezapft? (Schade, dass er nie als Komponist gewürdigt wurde. Er hätte es mehr als verdient.)
Und Arrangements von Paul Buckmaster: weit draußen. Grundgütiger!
Danke!